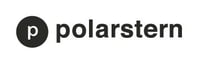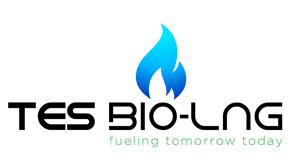Pressemitteilung
Ein großer Fortschritt bei der Betrugsbekämpfung:
Analyse der Initiative Klimabetrug Stoppen zu den geplanten Änderungen der BioSt-NachV und Biokraft-NachV
Berlin, 04.09.2025 Die geplanten Änderungen der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) und der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV) stellen einen bedeutenden legislativen Schritt dar, um die Mechanismen zur Betrugsprävention im deutschen Bioenergiesektor substanziell zu stärken. Insbesondere die Abschaffung der Anerkennung von unwirksamen Nachhaltigkeitsnachweisen ist ein unabdingbarer Schritt. Hier besteht großes Potenzial, Marktverwerfungen in Zukunft effektiver bekämpfen zu können. An einigen Stellen muss der Entwurf aber auch noch nachgeschärft werden.
Reform des Vertrauensschutzes für gefälschte Nachhaltigkeitsnachweise
Ein bizarrer Vorgang: Im Mai 2025 gab die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) temporär gesperrte Nachhaltigkeitsnachweise wieder frei – obwohl die BLE selbst davon ausging, dass die Nachweise von einer nichtexistenten Anlage stammten und gefälscht waren. Der Grund dafür war der sogenannte Vertrauensschutz, der bislang in § 17 Abs. 2 der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung festgeschrieben war. Dieser Paragraf wird im Referentenentwurf zur Biokraft-NachV reformiert. Das ist ein zentraler Schritt im Kampf gegen Betrug. „Bislang waren Behörden selbst bei bestätigtem Betrugsverdacht häufig die Hände gebunden. Mit der überfälligen Reform des § 17 können gefälschte Nachweise nun einfacher aberkannt werden. Das stärkt das Vertrauen in den Markt und sorgt für faire Bedingungen“, kommentiert Stefan Schreiber, Sprecher der Initiative.
Zertifizierungsstellen: Mehr Pflichten, mehr Befugnisse, mehr Betrugsprävention?
Mit dem Entwurf werden Zertifizierungsstellen stärker in die Pflicht genommen. Das geschieht hauptsächlich über drei verschiedene Wege: Die Ausweitung des Ordnungswidrigkeiten-Katalogs, die verpflichtende Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und klarere Vorgaben für die Kontrollen.
Wer Zertifikate oder Nachhaltigkeitsnachweise ausstellt, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt wurden, soll in Zukunft den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllen. Die verstärkte Haftung von Zertifizierern ist zwar ein sinnvoller Schritt, die Strafe ist aber für eine Abschreckungswirkung nicht ausreichend. Betrug mit Nachhaltigkeitszertifikaten ist Betrug am Klimaschutz und sollte als solcher als Umweltstraftat eingestuft werden. Diese können mit Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren, in schweren Fällen bis zu fünfzehn Jahren geahndet werden. So würde ein wirksames Signal für Marktintegrität gesendet werden.
Die verstärkte Haftung und Qualitätssicherung bei Zertifizierungsstellen sind insofern notwendig, als dass diese Stellen weitere Aufgaben übernehmen sollen. Im Rahmen der Betrugsprävention werden die Kontrollmöglichkeiten um einige sinnvolle Maßnahmen ergänzt. So soll beispielsweise neben weiteren Befugnissen bei begründeten Zweifeln eine Probenentnahme angeordnet und untersucht werden können. Außerdem sollen stichprobenartige Vor-Ort-Kontrollen bei Anfallstellen durchgeführt werden. Damit würde eine Lücke geschlossen, auf die die Initiative bereits bei der Veröffentlichung des Referentenentwurfs zur BImSchG, bzw. BImSchV-Novellierung aus diesem Jahr hingewiesen hatte.
Ein theoretisch wichtiger Schritt: Erweiterung des behördlichen Handlungsspielraums
Die zuständige BLE erhält einige erheblich erweiterte Befugnisse und Möglichkeiten zur Betrugsbekämpfung. Fraglich ist allerdings, ob die Behörde den Aufwand stemmen kann.
Zu den neuen Befugnissen gehören die Ermächtigung, explizite Unterlagen der untersuchten Unternehmen anzufordern, die Möglichkeit, Kontrollen selbst durchzuführen sowie stichprobenartige Überprüfungsverfahren anzuordnen. Zudem kann die zuständige Behörde gegenüber Zertifizierungsstellen die Anordnung treffen, Zertifikate auszusetzen oder zu entziehen, wenn die Voraussetzungen für die Ausstellung nicht erfüllt sind.
Die direkten Eingriffsrechte ermöglichen es der BLE, proaktiver gegen Betrugsverdacht vorzugehen, anstatt sich ausschließlich auf die Berichte oder Audits der Zertifizierungsstellen zu verlassen. Um diese Befugnisse effektiv nutzen zu können, benötigt die Behörde aber ausreichende Kapazitäten, insbesondere personell. Dies impliziert die Notwendigkeit von Investitionen in die BLE, um die notwendige Erweiterung der Befugnisse nicht aufgrund von Personalmangel wirkungslos verpuffen zu lassen.
Implementierung Union Data Base (UDB)
Die Union Data Base (UDB), auf die im Entwurf mehrfach verwiesen wird, kann in der Zukunft eine zentrale Rolle bei der Dokumentation einnehmen. Daher ist die Implementierung der UDB als Nachhaltigkeitsnachweis-System grundsätzlich zu begrüßen. Es gibt für die angeschlagene Branche aber keine Zeit, um auf den Einsatz der UDB zu warten.
Sinnvolle Maßnahmen, fehlende Konkretisierung
Der Entwurf eröffnet zwar einige weitere Möglichkeiten zur Überprüfung von Schnittstellen, Anfallstellen und Lieferanten, bleibt aber in den Details häufig zu unkonkret. Das gefährdet den Einsatz dieser Methoden und führt im schlimmsten Fall zu weiteren ungeahndeten Betrugsfällen. So ist die Nennung einer „repräsentativen Anzahl“ an jährlich zu kontrollierenden Anfallstellen zu vage, hier wäre eine konkrete Prozentzahl, beispielsweise nach der „Quadratwurzel-Formel“, besser. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Zertifizierungsstellen selbst definieren, wie viele Kontrollen notwendig sind.
Fazit
Der Referentenentwurf zur Novellierung der BioSt-NachV und Biokraft-NachV ist ein guter Schritt, um den deutschen THG-Quotenmarkt nachhaltig vor Betrug zu schützen. Insbesondere die Reform des Vertrauensschutzes für gefälschte Zertifikate stellt einen wichtigen Hebel da, um Betrug wirkungsvoll sanktionieren zu können. Nur so kann Betrug in Zukunft nicht mehr nur vorgebeugt, sondern auch sanktioniert werden. Weitere sinnvolle Änderungen sind zusätzliche und rigidere Kontrollen, unter anderem auch bei Anfallstellen. Auch die Stärkung der behördlichen Auskunfts- und Eingriffsrechte ist positiv, allerdings muss die BLE dann auch mit entsprechenden Kapazitäten ausgestattet werden.
Die Aberkennung von fälschlicherweise anerkannten Quotenbescheiden ist ein scharfes Schwert im Kampf gegen Klimabetrug. Wichtig ist, dass es auch eingesetzt wird – dazu müssen die Kontrollmechanismen lückenlos funktionieren. Die Novellierung ist dabei ein erster wichtiger Schritt, ohne eine rechtzeitige Umsetzung der RED III in deutsches Recht ist sie aber nur Stückwerk.
Pressekontakt
Initiative Klimabetrug Stoppen
E-Mail: kontakt@carbonleaks.de
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.carbonleaks.de
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.


.png?width=512&height=512&name=bildergalerie%20(2).png)

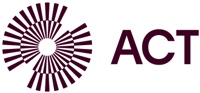












%20Logo.png?width=300&name=Biogas%20Wipptal%20(BIWI)%20Logo.png)
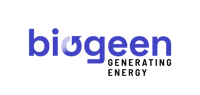
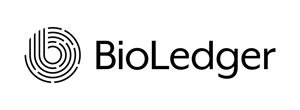
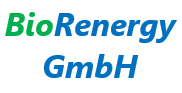

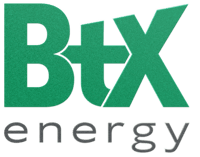


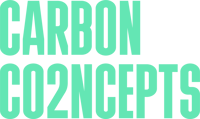








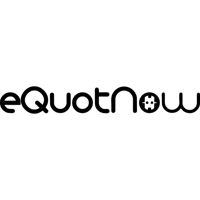





.png?width=200&name=Green%20Hydrogen%20Esslingen%20Logo%20(1).png)














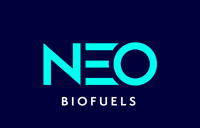
.png?width=200&name=oekobit_biogas_logo_compact_rgb%20(1).png)

.jpg?width=200&name=logo_ohraenergie_4c%20(nur%20bis%2028.08.%20g%C3%BCltig).jpg)